
30.10.2023
"Niemand war zu Recht im KZ"
Wohnungs- und Arbeitslose wurden im Dritten Reich als "Asoziale" und "Berufsverbrecher" diskriminiert, verfolgt und in Konzentrationslager deportiert. Erst 2020 wurden sie als Opfergruppe durch den Bundestag anerkannt.
Diskussionsveranstaltung am 22. November 2023 in der Passionskirche, Marheinekeplatz 1, 10961 Berlin
Über die späte Anerkennung der sogenannten „Berufsverbrecher“ und „Asozialen“ als Opfergruppe des Nationalsozialismus
Diskussionsveranstaltung mit Prof. Dr. Frank Nonnenmacher (Frankfurt a.M.) und Dr. Julia Hörath (Hamburg), Moderation: Dieter Pienkny
am 22. November 2023 von 18:30 bis 20:30 Uhr in der Passionskirche; Marheinekeplatz 1, 10961 Berlin
Das Berliner Arbeitslosenzentrum setzt sich gegen die Diskriminierung von einkommensarmen und arbeitslosen Menschen ein. Ressentiments des sogenannten Klassismus begegnen uns im Alltag, aber auch in Debatten über sozialpolitische Vorhaben, wie zuletzt zur Kindergrundsicherung. Menschen, die Hilfe benötigen, mit Abweisungen und Schuldvorwürfen zu begegnen, ist ein moralisches Problem unserer Zeit. Hierzu bestehen historische Kontinuitäten, die bis in das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte reichen.
Wohnungs- und Arbeitslose wurden im Dritten Reich als "Asoziale" und "Berufsverbrecher" diskriminiert, verfolgt und in Konzentrationslager deportiert. Zirka 80.000 Menschen waren hiervon betroffen und viele überlebten die NS-Zeit nicht. Es waren sowohl Mehrfachstraftäter unter ihnen, als auch Personen, die bettelten, einfach nur eine Arbeitsstelle abgelehnt hatten, oder unentschuldigt ihren Arbeitsplatz verließen. Ihre Rehabilitation im Nachkriegsdeutschland wurde mit der Behauptung abgelehnt, sie wären „zu Recht“ in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern gewesen. Obwohl im Auschwitzprozess Anfang der 60er Jahre ein KZ-Opfer dieser Gruppe als Zeugin angehört wurde, spielte die NS-Verfolgung dieser Menschen in der deutschen Erinnerungspolitik keine Rolle. Erst im Jahr 2020 wurden sie als letzte Opfergruppe durch den Deutschen Bundestag anerkannt. Das ist maßgeblich auf Initiative von Frank Nonnenmacher, Dagmar Lieske und Julia Hörath geschehen.
Nonnenmacher und Hörath werden am 22. November mit zwei thematischen Impulsen den historischen Hintergrund, die Initiative und die Gründung des Opferverbands darstellen, sowie eine Kritik an der mangelhaften Umsetzung des Bundestagsbeschlusses vom Januar 2020 vortragen und dann mit dem Publikum diskutieren. Mit dieser Veranstaltung möchte das BALZ die Initiative „Niemand war zu Recht im KZ“ unterstützen.
Anmeldung bitte unter:
Gefördert von der Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt: https://www.stiftungmunda.de/


 Beratung zu Arbeitslosengeld und Bürgergeld
Beratung zu Arbeitslosengeld und Bürgergeld Aktuelles
Aktuelles  Über uns
Über uns 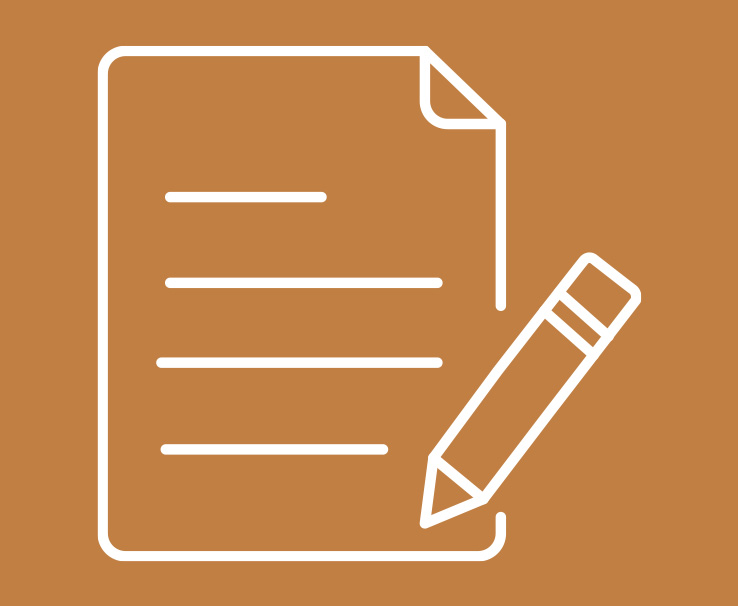 Infomaterial
Infomaterial  Angebote für Beratende
Angebote für Beratende  Gruppen
Gruppen  FAQ
FAQ 